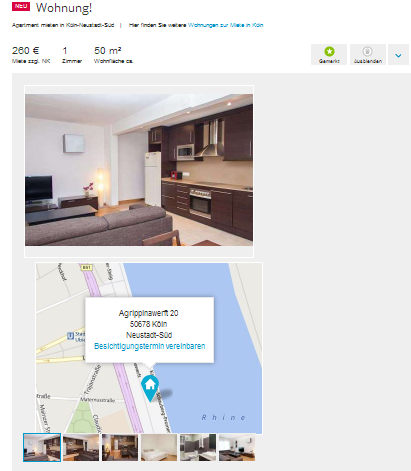Inhalt
„Durch ihre vergleichsweise einfache Herstellungsweise sind sie kostengünstiger als herkömmliche Infrarotsensoren“, erklärt Autor Sven Jachalke, Doktorand am Institut für Experimentelle Physik. Die Einsatzmöglichkeiten von Wärmedetektoren sind vielfältig, so können sie bspw. zum Aufspüren von Leitungsdefekten oder Brandherden verwendet werden.
 Mit Hochdruck forschen die Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Verbindungshalbleiter und Festkörperspektroskopie um Prof. Dr. Dirk C. Meyer am Institut für Experimentelle Physik daher an pyroelektrischen Funktionsmaterialien. Diese zeichnen sich durch einen besonderen kristallphysikalischen Effekt aus, der durch eine Temperaturänderung zum Aufbau eines elektrischen Feldes führt. Damit bietet diese besondere Materialklasse der Pyroelektrika neben ihrer Verwendung in empfindlichen Infrarot-Sensoren großes Potential bei neuartigen chemischen Katalysen, der Röntgenstrahlerzeugung und vor allem der Niedertemperatur-Abwärmenutzung.
Mit Hochdruck forschen die Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Verbindungshalbleiter und Festkörperspektroskopie um Prof. Dr. Dirk C. Meyer am Institut für Experimentelle Physik daher an pyroelektrischen Funktionsmaterialien. Diese zeichnen sich durch einen besonderen kristallphysikalischen Effekt aus, der durch eine Temperaturänderung zum Aufbau eines elektrischen Feldes führt. Damit bietet diese besondere Materialklasse der Pyroelektrika neben ihrer Verwendung in empfindlichen Infrarot-Sensoren großes Potential bei neuartigen chemischen Katalysen, der Röntgenstrahlerzeugung und vor allem der Niedertemperatur-Abwärmenutzung.
Die Herstellung solcher pyroelektrischen Oxidmaterialien ist oft komplex und mit hohen Kosten verbunden. Durch die Entdeckung von Ferroelektrizität, die mit der Pyroelektrizität eng verwandt ist, in Nanometer-Schichten aus Hafniumoxid (HfO2) im Jahre 2011 offenbarten sich plötzlich völlig neue Möglichkeiten für dieses Material. In der Halbleiterindustrie ist HfO2 bereits seit vielen Jahren ein etabliertes Materialsystem für Speicherzellen. Die seitdem stetig wachsende Publikationszahl zeigt, dass Ferroelektrizität durch gezieltes Einbringen von verschiedenen chemischen Elementen – z. B. durch Dotierung mit Strontium oder Aluminium – erreichbar ist. Die ferroelektrischen Eigenschaften sind bereits sehr gut untersucht, jedoch mangelt es noch an einschlägigen Berichten über die pyroelektrischen Eigenschaften, wodurch sich das Material auch über die Anwendung als Datenspeicher hinweg nutzen ließe.
In Kooperation zwischen dem NaMLab Dresden und dem Institut für Experimentelle Physik der TU Bergakademie Freiberg wurden daher nun die pyroelektrischen Eigenschaften solcher HfO2-Dünnschichten untersucht. An Silizium-dotiertem HfO2 zeigte sich, dass die erreichbaren pyroelektrischen Koeffizienten und Gütefaktoren vergleichbar mit denen von bereits etablierten Stoffsystemen sind. Im Gegensatz zu diesen lässt sich HfO2 aber ohne weiteres kostengünstig als Nanometerschicht herstellen. „Trotz guter Eigenschaften des Materials bedarf es noch einiger Arbeit um das Material in einen tatsächlichen Sensor zu bringen“, erklärt Sven Jachalke.
Weitere Informationen:
Artikel: https://doi.org/10.1063/1.5023390
IEP: http://tu-freiberg.de/exphys
NaMLab: http://www.namlab.de